Was kostet die Umwelt?
wie Sie sehen, bin ich nicht Kerstin Eitner. Die hochgeschätzte Kollegin genießt ein paar freie Tage. In der Vergangenheit ist die Wochenauslese in solchen Momenten einfach ausgefallen. Schade eigentlich, dachten wir uns, und haben beschlossen, dass Sie bei derlei Gelegenheit nun jeweils eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege begrüßen darf.
Den Anfang mache ich. Für Mitte Juli sind politische Betrachtungen eine eher undankbare Zeit. Das Sommerloch lässt sich in den Redaktionen oft nur mit niedlichen Tiergeschichten oder bunten Rätselseiten stopfen. Dieses Jahr fühlt es sich aber ganz und gar nicht nach notdürftig gefüllten Seiten an. Anfang der Woche etwa endete der große EU-Sondergipfel zum EU-Haushalt und zum Corona-Wiederaufbau – für die Teilnehmenden wurde aus einem Wochenende ein verlängertes, so intensiv feilschten, pokerten, blufften sie. Kein Wunder, ging es doch um gigantische 1,8 Billionen Euro. Doch im Gerangel der Gipfelstürmer um Rechtsstaatlichkeit und um die Finanzierung der Coronahilfen ging unter, worum es bei diesem Marathontreffen eigentlich hätte gehen sollen und müssen: eine ökologische Modernisierung und den Masterplan für den Klimaschutz. Der blieb am Ende bloß Randnotiz.
Zwar sollen dreißig Prozent der 1,8 Billionen Euro in den kommenden sieben Jahren in den Klimaschutz fließen – und auch die anderen siebzig Prozent sollen den Pariser Klimazielen dienen – doch einen handfesten Kriterienkatalog für die klimaschutzorientierte Vergabe der Mittel gibt es nicht. Und reicht das Geld überhaupt? Die Denkfabrik Agora Energiewende hatte vor kurzem ausgerechnet: 2,4 Billionen Euro – 2400 Milliarden – müssten eigentlich in Gebäude, den Verkehr, Strom und in die Industrie investiert werden, wollte die EU ernsthaft ihre Klimaziele erreichen.
Könnte es also passieren, dass ausgerechnet die USA beim Thema Klimaschutz demnächst an Europa vorbeiziehen? Vergangene Woche verkündete Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden, mit ihm als Präsident würden die USA schon bis 2035 klimaneutral, 15 Jahre früher als Europa. Dafür möchte er sage und schreibe zwei Billionen Dollar (also gut 1,7 Billionen Euro) in den nächsten vier Jahren ausgeben. Unter seinen Vorschlägen sind die üblichen, etwa der Ausbau erneuerbarer Energien. Ungewöhnlich ist aber die Idee, ein „Civilian Climate Corps“ aufzubauen, also eine Art Armee von Menschen, die beim Aufbau klimaneutraler Infrastruktur und der Renaturierung von Ökosystemen mit anpacken sollen. Bravo, mag man da über den Atlantik rufen – und hoffen, dass Bidens Green New Deal kein bloßes Wahlkampfgetöse bleibt.
Übrigens, schon Franklin D. Roosevelt hatte als elementaren Bestandteil seines New Deal zur Bekämpfung der Great Depression im Jahr 1933 ein „Civilian Conservation Corps“ ins Leben gerufen – um die „kostbaren natürlichen Ressourcen“ zu bewahren. Damals hatte er vorhergesagt, dass das Korps durch seine Arbeit „den gegenwärtigen und zukünftigen Generationen Dividenden zahlen wird“.
Dass es bei dem Programm auch und hauptsächlich um den wirtschaftlichen Wiederaufstieg der Vereinigten Staaten ging, ist für die heutige Debatte besonders interessant, wurden doch jahrzehntelang Naturschutz und ökonomischer Nutzen als Gegenspieler betrachtet. Wie eng aber beide zusammenhängen, hat vor kurzem ein Team aus über hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen gezeigt. Ihr Report „Protecting 30% of the planet for nature“ ist eine Kosten-Nutzen-Analyse des sogenannten 30-bis-30-Ziels. Dabei handelt es sich um das von großen Umweltorganisationen und einigen Staaten vorangetriebene Vorhaben, dreißig Prozent der Land- und Meeresfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen. Wie das Forscherteam herausfand, würde sich das finanziell lohnen: Jeder investierte Euro brächte fünf Euro Ertrag. Die Schutzgebiete könnten gut 500 Milliarden Dollar erwirtschaften, zum Beispiel durch umweltfreundlichen Tourismus oder weil bestimmte „Ressourcen“ sich erholen: Je besser sich etwa Fische in Meeresschutzgebieten vermehren, desto mehr gibt es von ihnen – auch dort, wo gefischt werden darf. Experten nennen das den Übertragungs- oder Spillover-Effekt. Und: Naturschutz kann vor Zerstörungen durch extremes Wetter bewahren, indem er die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen steigert. 350 Milliarden Dollar könnte die Welt so einsparen – durch „Ökosystemdienstleistungen“ wie Hochwasserschutz, Erosionsschutz, Küstenschutz.
Ökosystemdienstleistungen. Das Wort hat Konjunktur. Mir sträuben sich automatisch die Nackenhaare, wenn das Vokabular, mit dem Natur- und Umweltschutz begründet wird, der kapitalistischen Verwertungslogik entstammt. Allein schon die Natur einer Kosten-Nutzen-Analyse zu unterziehen, erscheint fragwürdig. Doch man kann sich auch die kapitalistische Logik zu eigen machen, um zu zeigen, dass ebendiese nicht funktioniert. Würden etwa die wahren Umweltkosten der Massentierhaltung – Nitratbelastung, CO2-Ausstoß, Tierleid, Menschenleid – in jedes Kilo Billigfleisch eingerechnet, unser Fleischkonsum läge längst viel niedriger. Mit anderen Worten: Es würde wohl helfen, den Spieß endlich umzudrehen und nicht die gute Sache zu Markte zu tragen, sondern den Markt in den Dienst der guten Sache zu stellen. Umso besser, wenn der Spieß kein Spanferkel dreht, sondern Auberginen und Zucchini. Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende!


Frauke Ladleif
Redakteurin
Levi Perner und Paul Blaschke
Susanne Jordan
Einladung zum Rundgang
es ist Ihnen sicher nicht entgangen: Wir haben unserem alten Online-Auftritt leise „Servus“ gesagt, die Greenpeace Magazin-Website aufgeräumt und auch optisch runderneuert. Dabei war uns vor allem wichtig, dass sie benutzerfreundlicher wird und Ihnen bessere Orientierung bietet. Also haben wir sämtlichen Bereichen feste Plätze zugeordnet, leicht zu finden über die Menüleiste oben.
Hier finden Sie – so hoffen wir zumindest – alles Wissenswerte über das Greenpeace Magazin (einschließlich neu eingerichteter Leseecke), nach Themen sortierte Online- und Printartikel und unsere ständigen Rubriken. Unter dem neuen Menüpunkt „Über uns“ erzählen wir Ihnen, wer wir sind, wer was macht, was wir so alles publizieren und wo wir herkommen. Sie erfahren, wo Sie uns auch mal live vor Ort treffen können, ob wir Verstärkung suchen und natürlich auch, wie Sie uns kontaktieren.
Auch unsere Newsletter sind noch da, haben aber neben einem neuen Outfit auch neue Namen bekommen: Der Daily Navigator heißt jetzt Presseschau und die wöchentliche Kolumne Wochenauslese. Selbstverständlich können Sie sich beide auch weiterhin direkt in ihr Postfach bestellen. Außerdem erwarten Sie auf der Startseite wie immer Online-Berichte zu aktuellen Themen.
Beim Weiterklicken werden Sie feststellen, dass unser Online-Shop „Warenhaus“ zwar immer noch so heißt, sein Erscheinungsbild aber ebenfalls geändert hat. Nicht geändert hat sich das Angebot: hochwertige, nachhaltige Dinge zum Anziehen, Leben oder Lesen. Diese entsprechen unseren strengen Greenpeace-Kriterien und werden von uns mit Sorgfalt ausgewählt und hergestellt. In unserem neuen Shop haben wir Platz geschaffen, um Ihnen die Geschichten zu den Produkten zu erzählen und Ihnen die Menschen und Ideen dahinter vorzustellen.
Es versteht sich von selbst, dass inhaltlich trotz umfänglicher Renovierungsarbeiten natürlich das bleibt, wofür wir als Redaktion stehen: spannende Geschichten und relevante Debatten, manchmal mit einem Augenzwinkern serviert. Und es ändert sich auch nichts an unserer Themenpalette, die von den Dauerbrennern Klimawandel sowie Umwelt- und Naturschutz über soziale Themen wie Ausbeutung und Gleichberechtigung bis hin zu grüner Politik, Nachhaltigkeitstrends oder Skurrilem aus der Tierwelt reicht.
Wir hoffen natürlich, dass Ihnen das Ganze gefällt. Viel Vergnügen beim Stöbern, Betrachten und Lesen!
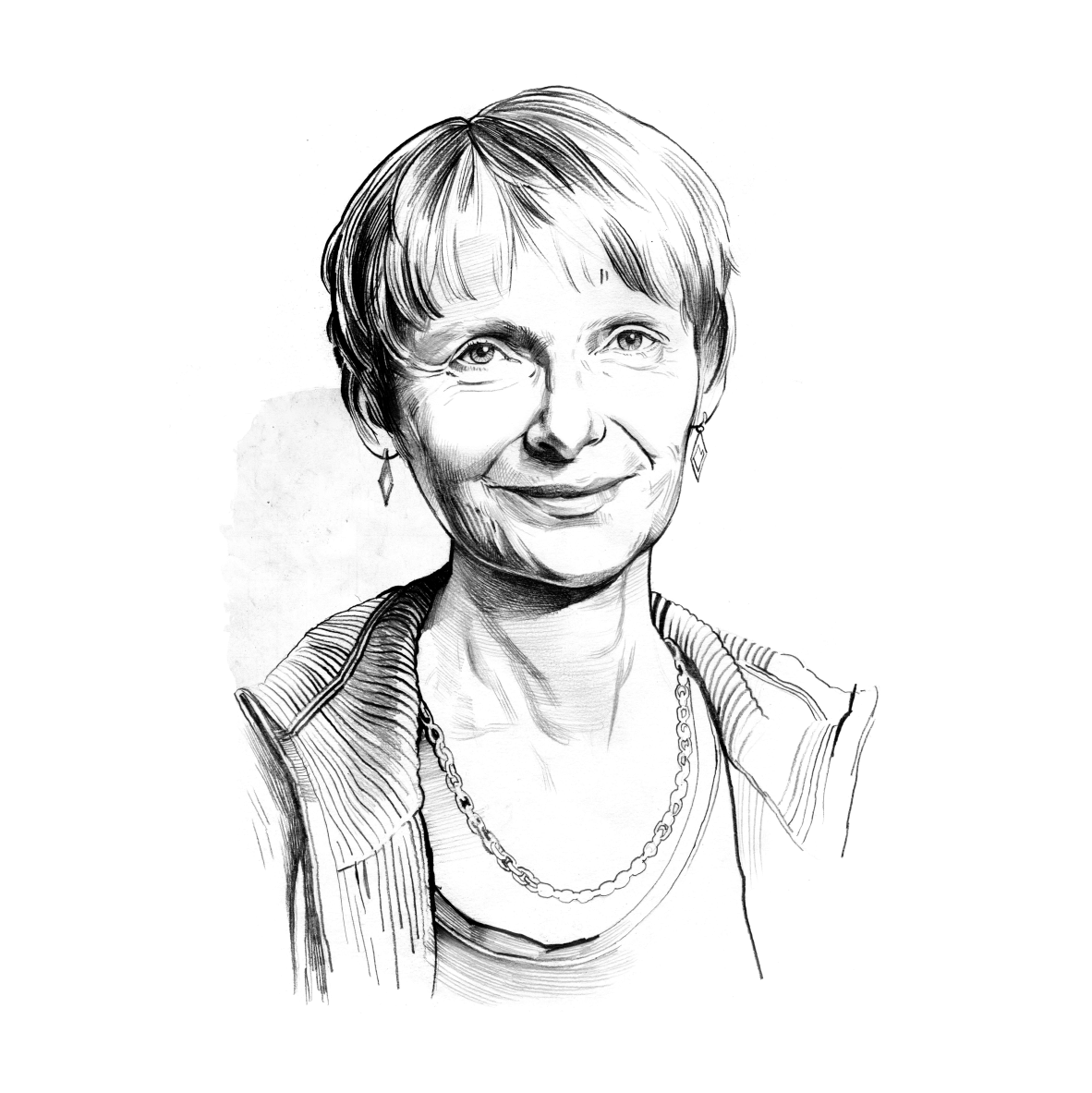
Kerstin Eitner
Redakteurin
You can't sink a rainbow
der 10. Juli 1985 schien ein ganz normaler Tag zu sein. Wie an jedem Wochentag in diesem Jahr war ich an meinem Arbeitsplatz im Greenpeace-Büro am Hamburger Elbufer. Es gehörte zu meinen Aufgaben als Assistentin, ein- und ausgehende Fernschreiben zu verteilen und zu archivieren. Fax und Mail waren noch Zukunftsmusik. Schriftliche Nachrichten verarbeitete mit viel Geratter das heute fast ausgestorbene Telex, eine Art klobige Schreibmaschine mit Telefonanschluss, die mit ellenlangen papierenen Lochstreifen gefüttert wurde.
An diesem Tag tickerte eine Nachricht aus dem südenglischen Lewes herein, dem damaligen Hauptquartier von Greenpeace International, die im wahrsten Sinne des Wortes einschlug wie eine Bombe. Ihr Wortlaut in etwa: „Am 10. Juli um kurz vor Mitternacht Ortszeit ist die Rainbow Warrior im Hafen von Auckland nach zwei Explosionen gesunken. Bitte versucht nicht, wiederhole: NICHT, im neuseeländischen Büro anzurufen, alle Leitungen sind blockiert.“
Nun überschlugen sich die Ereignisse: Wenig später stand fest, dass der Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira in seiner Kabine ertrunken war, offenbar bei dem Versuch, seine Kamera zu retten. Pereira, gebürtiger Portugiese, gerade 35, hatte mit seiner Frau und zwei Kindern in den Niederlanden gelebt. Zuletzt hatte er dokumentiert, wie die Rainbow Warrior im Mai nach und nach 327 Menschen mit Sack und Pack von der durch den US-Atomtest „Bravo“ verseuchten Pazifikinsel Rongelap auf die weiter südlich gelegene Insel Mejato umsiedelte.
Schnell konnten die hartnäckigen neuseeländischen Ermittler bestätigen, was die Spatzen überall auf der Welt von den Dächern pfiffen: Es war ein Bombenattentat. Agenten des französischen Auslandsgeheimdienstes DGSE hatten das Schiff mit Haftminen versenkt und den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen, wenn nicht gar beabsichtigt. Denn wenn ich kurz vor Mitternacht zwei große Löcher in einen Schiffsrumpf sprenge, muss ich annehmen, dass einige Crewmitglieder schlafend in ihren Kojen liegen. Mit der „Opération Satanique“ sollte die Rainbow Warrior um jeden Preis davon abgehalten werden, zur geplanten Protestfahrt gegen französische Atomversuche auf dem Moruroa-Atoll auszulaufen.
Glück im Unglück: Erstens hatte die Crew am selben Abend den Geburtstag des US-amerikanischen Kampagnenleiters Steve Sawyer gefeiert, einige waren noch wach. Zweitens hatten die verschiedenen Agententrupps sich selten dämlich angestellt (was für Spott bei der CIA und dem britischen Geheimdienst MI5 sorgte). Die freundlicherweise hinterlassenen Spuren waren etwa so breit wie die Champs-Élysées. Es ist nicht viel los im Winter in Neuseeland. Da registriert die Bevölkerung seltsames Verhalten vermeintlicher ausländischer Touristen aufmerksam und gibt ihre Beobachtungen auch gern an die Polizei weiter.
Der damalige neuseeländische Premierminister David Lange sprach es als Erster aus: Die Versenkung der Rainbow Warrior in Auckland sei ein „terroristischer Akt“ gewesen. Zwei der Agenten, Dominique Prieur und Alain Mafart, vorgeblich ein Schweizer Paar namens Sophie und Alain Turenge auf Hochzeitsreise (Flitterwochen! Mit dem Campingbus! Im Winter!), wurden schnell festgenommen.
Irgendwann im August bekam ich spät abends einen Anruf: Ich möge doch bitte sofort nach Paris kommen. Das internationale Greenpeace-Team in der französischen Hauptstadt brauche Unterstützung. Damals war mein Französisch ganz passabel. Also hastig gepackt, Bargeld geliehen (Bankautomaten? EC-Karten? Zukunftsmusik, siehe oben), gerade noch in den Nachtzug gesprungen und am frühen Morgen an der Gare du Nord ausgestiegen. Ein paar Wochen lang konnte ich aus nächster Nähe den Reigen von Dementis und Vertuschungsmanövern seitens der französischen Regierung miterleben. Es fühlte sich unwirklich an, dass Greenpeace plötzlich im Zentrum einer Staatsaffäre stand.
Die Presse ließ der französischen Regierung ihre Lügen nicht durchgehen, auch Greenpeace stellte eigene Recherchen an. Im September trat schließlich Verteidigungsminister Charles Hernu zurück, Geheimdienstchef Pierre Lacoste wurde gefeuert. Premierminister Laurent Fabius – jener Fabius, der 30 Jahre später als Außenminister den Pariser Klimagipfel nicht ungeschickt leitete – musste, obwohl selbst an der Verschwörung nicht beteiligt, vor die Kameras treten und alles zugeben. „Die Wahrheit ist grausam“, sagte er.
Prieur und Mafart wurden 1986 in Neuseeland zu zehn Jahren Haft verurteilt und sollten ihre Strafe auf der französischen Militärbasis Hao im Südpazifik verbüßen, konnten aber schon nach weniger als zwei Jahren nach Frankreich zurückkehren. Die anderen acht beteiligten Agenten standen nie vor Gericht. Stattdessen wurden alle später ausgezeichnet und befördert, auch Frédérique Bonlieu alias Christine Cabon, die vorab das neuseeländische Greenpeace-Büro ausspioniert hatte. Admiral Lacoste schrieb 2005 in seinen Memoiren, Staatspräsident François Mitterrand habe die Operation abgesegnet, was man bereits geahnt hatte.
Weltweit erfuhr Greenpeace viel Sympathie, moralische und finanzielle Unterstützung, und gewann neue Mitglieder, außer in Frankreich, wo die Stimmung immer feindseliger wurde. Die MS Greenpeace fuhr anstelle der Rainbow Warrior nach Moruroa, begleitet von einer Flottille aus kleineren Booten. Ein Jahr nach dem Attentat zahlte Frankreich auf internationalen Druck gut sieben Millionen US-Dollar Entschädigung an Neuseeland. 1987 verurteilte ein Schiedsgericht in Genf das Land zu einer Schadensersatzzahlung an Greenpeace in Höhe von über acht Millionen Dollar. Die gesäuberten Überreste der Rainbow Warrior ruhen heute als künstliches Riff auf dem Grund der neuseeländischen Matauri Bay, an Land erinnert ein Denkmal an sie.
Schon früh machte in all dem Chaos dieser Spruch die Runde, vielleicht kam er aus Neuseeland, aber genau weiß ich das nicht: „You can’t sink a rainbow“ – einen Regenbogen kann man nicht versenken. So war es, so ist es, und so wird es bleiben.
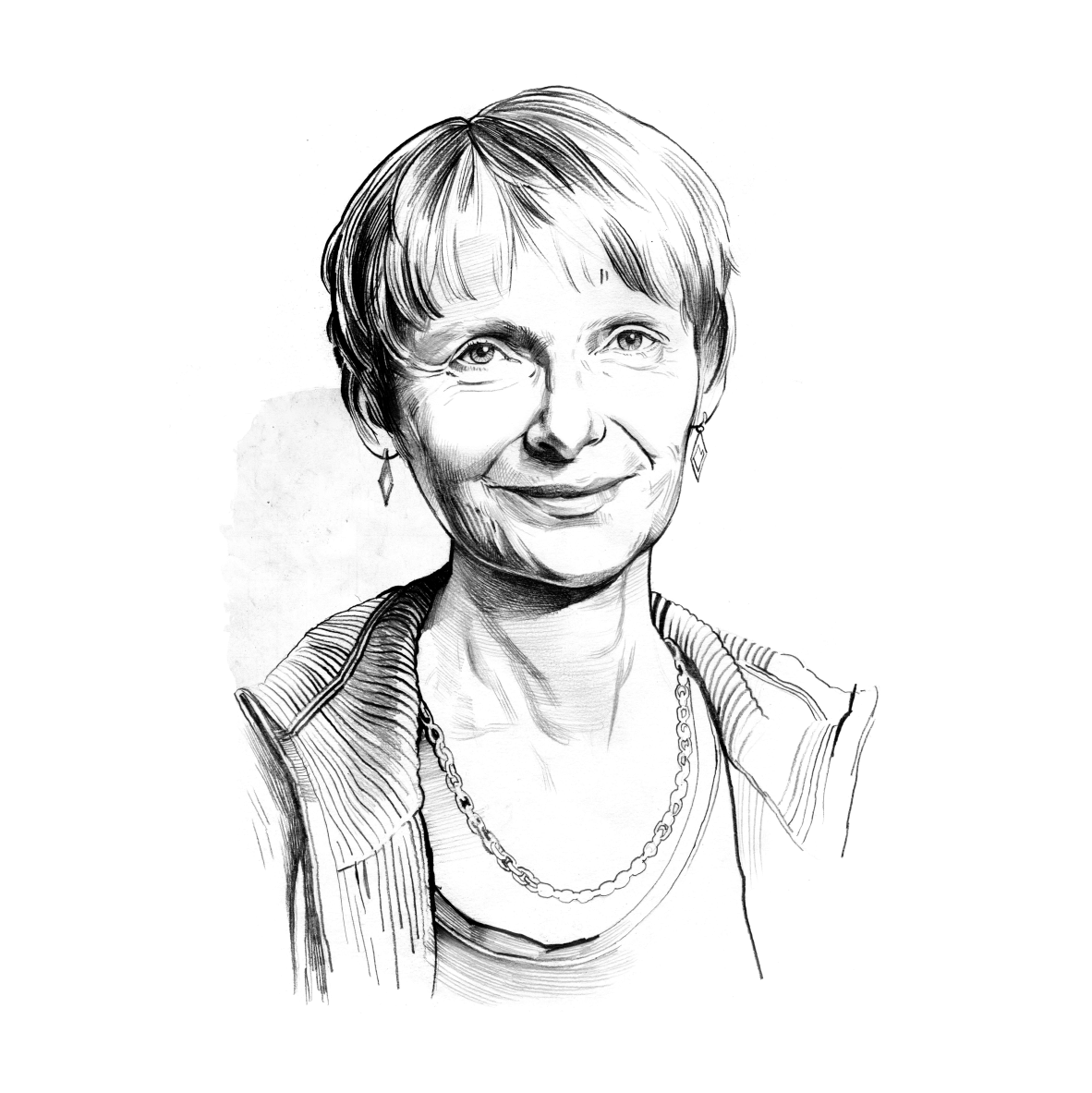
Kerstin Eitner
Redakteurin