Platz da – aber wo?
„Rentner blockieren große Wohnungen“, titelte einst Focus Online. Au weia. Zeit für Wohnscham, denn auch ich beziehungsweise wir bewohnen zu zweit knapp 130 klima- und umweltpolitisch verwerfliche Quadratmeter, und das bei dem vor allem in Ballungsräumen herrschenden Wohnraummangel. Zu meiner Verteidigung kann ich vorbringen: kein Auto, weder Flug- noch sonstige Luxusreisen, Erwerbstätigkeit im heimischen Arbeitszimmer schon lange vor der Erfindung des Homeoffice.
Aber ach, die armen Familien! Sollte man nicht besser umziehen? Leichter gesagt als getan. Denn ich bin das einzige Überbleibsel der wechselnden, teils extrem chaotischen Wohngemeinschaften, drei, vier, manchmal auch mehr Leute, die sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts vier Zimmer, zwei Abstellkammern, Küche, Bad, Klo und einen übertrieben riesigen Flur teilten. Das heißt: Wir haben einen alten Mietvertrag und daher eine sehr günstige Miete.
Was auch daran liegt, dass wir vor über dreißig Jahren auf eigene Kosten eine, ähem, Gasetagenheizung haben einbauen lassen, nicht ahnend, dass wir uns damit einmal direkt ins Reich des Bösen begeben würden. Damals schien es eine grandiose Idee zu sein, Ersatz für eine noch weit schlimmere Heizart: Kohleöfen (Briketts schleppen! Asche entsorgen! Das Grauen!!); wir blieben im Rasterfeld B4 des Mietenspiegels (mit Bad oder Sammelheizung) und damit bis heute von exorbitanten Mieterhöhungen verschont.
Nehmen wir mal an, wir trügen uns mit Umzugsgedanken. Da würde man sich natürlich nicht unbedingt verschlechtern wollen.
„Ja, das möchtste:
Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,
vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;
mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,
vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn –
aber abends zum Kino hast du´s nicht weit.
Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit.“
So märchenhaft wie in Tucholskys Gedicht müsste die Bleibe gar nicht sein. Jedoch: Ein Balkon wäre zur Abwechslung nicht übel, eine weniger laute Umgebung ebenso wenig, aber bitte trotzdem nicht zu weit weg, keinesfalls am Stadtrand und schon gar nicht auf dem Land.
Mal angenommen, man fände was – jede Wette, es wäre eher halb so groß und kaum billiger als unsere derzeitige Wohnung. Nach deren Renovierung könnte die Vermietungsgesellschaft ohne Weiteres die doppelte Miete kassieren, denn die darf ja bei jeder Neuvermietung erhöht werden. Womit niemandem gedient wäre, weil es ja vor allem an bezahlbarem Wohnraum fehlt. Wohnungstausch – das klingt nicht schlecht, scheitert in der Praxis aber häufig.
Auf dem Land läuft auch nicht alles rund: Das Einfamilienhaus mit Garten, Kugelgrill, Carport, Trampolin und Plantschbecken (gibt es eigentlich noch Jägerzäune und Gartenzwerge?), der ewige Traum der meisten Deutschen, ist aus ökologischer Sicht häufig ein Albtraum, vor allem, wenn es in den Vororten liegt, den „Speckgürteln“ der Städte. Ausufernde Eigenheimsiedlungen, gern errichtet in frisch ausgewiesenen Neubaugebieten, führen zu dem allseits gefürchteten Donut-Effekt in Dörfern und Städten – im Innenbereich Leerstand, außerhalb Siedlungsbrei und Flächenfraß. Wird die Immobilie irgendwann vererbt, heißt es oft: Verkauf, Abriss, Neubau.
Die große Koalition hielt es kurz vor der letzten Bundestagswahl für eine gute Idee, diese Fehlentwicklung in Gestalt von § 13 Baugesetzbuch zu zementieren. Dieser noch relativ neue Paragraph regelt die „Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“. Umwelt- und sonstige Verträglichkeitsprüfungen für Siedlungserweiterungen am Ortsrand entfallen, es gilt das Mantra „Bauen, bauen, bauen“.
Nicht alle spielen mit. Michael Werner-Boelz (Grüne), Bezirksamtsleiter in Hamburg-Nord, erklärte bei seinem Amtsantritt im Februar 2020, in seinem Bezirk kein Einfamilienhaus mehr genehmigen zu wollen. Die Wohnungsnot lässt sich damit ohnehin nicht beheben, denn so ein Haus kostet in Hamburg leicht mal 800.000 Euro, die man erst mal haben muss. Doch als Anton Hofreiter, damals noch Fraktionschef der Grünen im Bundestag, 2021 in einem Interview danach gefragt wurde und seine Skepsis gegenüber dieser Wohnform erklärte, sorgte das erwartungsgemäß für große Aufregung. Dieses Jahr hat nun auch die Stadt Münster (der Bürgermeister ist von der CDU) beschlossen, den Neubau von freistehenden Einfamilienhäusern zu beschränken, weitere Städte könnten nachziehen.
Patentlösungen sind nicht in Sicht. Interessante Ideen gibt es aber durchaus, von der Nachverdichtung auch bei Einfamilienhäusern, der Verwendung ökologischer Baumaterialien, neuen Wohn- und Arbeitskonzepten wie Coworking Spaces bis zu zügiger Digitalisierung und vielem anderen.
Es müsste eine Bestandsaufnahme her – und ein vernünftiger Gesamtplan. Man ahnt irgendwie, dass das mit den real existierenden und regierenden Parteien schwierig wird. Wenn man an das Gezerre und Gekeife um das Gebäudeenergiegesetz denkt, wird einem ganz anders bei der Vorstellung, es ginge nicht „nur“ um Heizen und Energieverbrauch, sondern um das Wohnen der Zukunft. Dabei ist eins klar: „Weiter so“ ist keine Option.
Also: Wenn jemand eine bezahlbare Wohnung im Innenstadtbereich von Hamburg im Angebot hat, zwischen Schuhschachtel- und Palastgröße, mit Balkon, verkehrsgünstig gelegen, aber nicht an einer viel befahrenen Straße, bitte melden. Nur ernst gemeinte Zuschriften!
Nächste Woche produzieren wir ein neues Greenpeace Magazin. Wir melden uns so bald wie möglich wieder.
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gern weiter. Abonnieren können Sie sie übrigens hier. Und wenn Sie auch unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimathemen lesen möchten, können Sie sich hier dafür anmelden – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
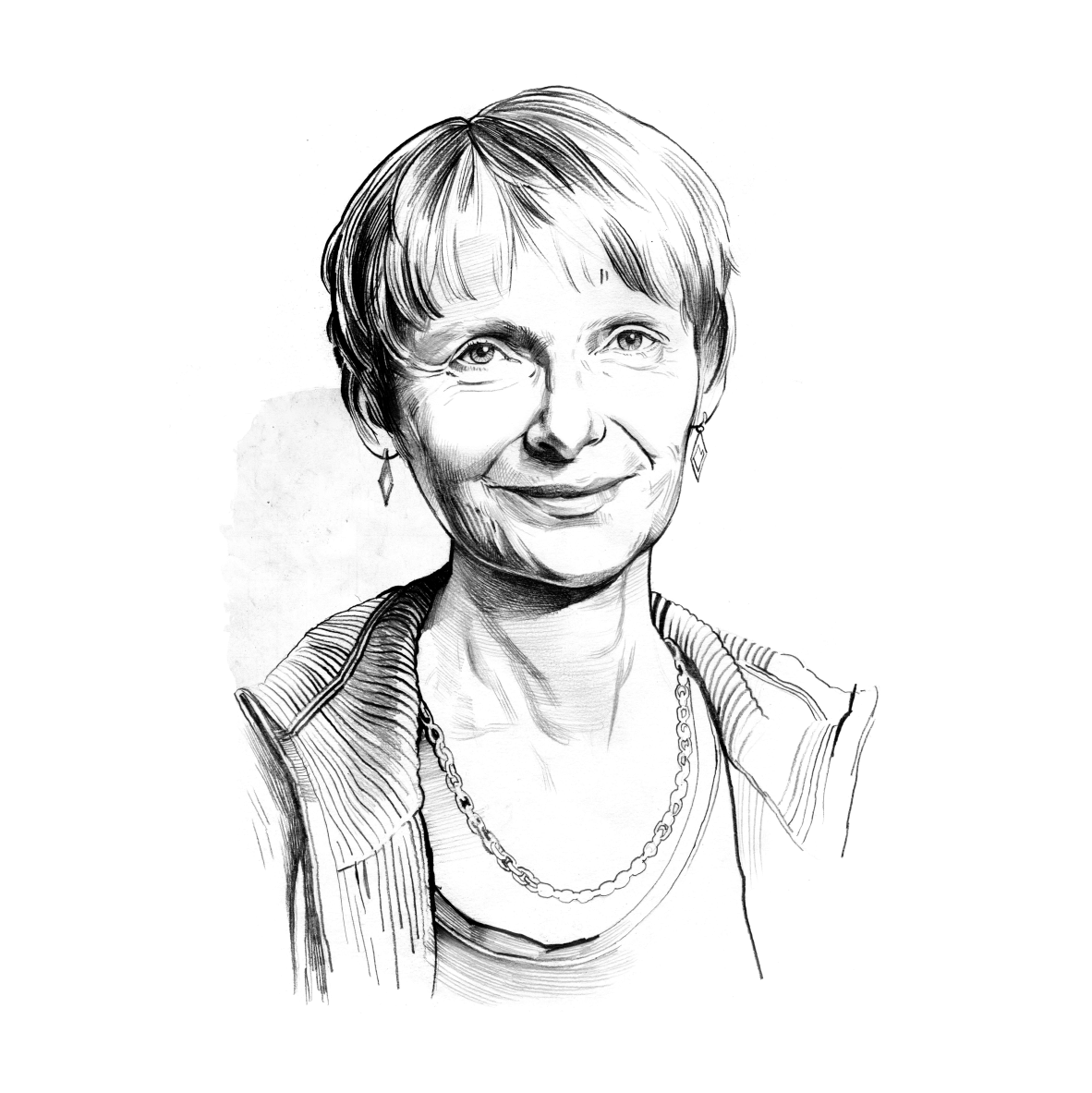
Kerstin Eitner
Redakteurin
Disneyland am Nordseestrand
nach drei Jahren Abwesenheit wegen Corona und anderen Kalamitäten haben wir meiner alten Heimat Sylt einen Besuch abgestattet. Sie hat sich, soweit man das feststellen kann, nicht vom Fleck bewegt. Sonne und Wind, Dünen und Wellen, Strandleben und Feriengäste: alles noch oder wieder da. Wie üblich viel Autoverkehr mit hohem SUV-Aufkommen, aber auch Hochbetrieb auf den Fahrradtrassen.
Häufig begegnet man Fahrrädern mit Anhängern, vornehmlich genutzt von Familien. Aber nicht Mama, Papa, Kind, sondern: Herrchen, Frauchen, Hundchen. Bello oder Fiffi lassen sich in ihrer mobilen Hundehütte umherkutschieren und zwischendurch sicher gern mit Hundeeis füttern. Erhältlich am Kampener Strand, in Geschmacksrichtungen wie Huhn, Rind oder Wildlachs, die Kugel für schlappe 3,50 Euro.
Auch Finanzminister Christian Lindner hat sich nicht lumpen lassen, so eine dreitägige Hochzeitssause auf Sylt gibt es ja nicht im Sonderangebot. Auf der Insel bleibt man bei Promi-Events aller Art, so auch bei diesem, aus alter Gewohnheit eher entspannt. Von Oppositionspolitikern in ihren fliegenden Kisten lässt sich hier auch niemand aus der Ruhe bringen. Eher schon vom verschärften Personalmangel. Restaurants müssen in der Hochsaison unfreiwillig Ruhetage einlegen oder gleich ganz schließen. Wohnraummangel, exorbitante Mieten, immer weiter steigende Lebenshaltungskosten – und die Pendelei in ewig verspäteten, ausfallenden und jetzt noch von 9-Euro-Reisenden überfüllten Zügen macht auch wenig Spaß. Wenn das so weitergehe mit den Arbeitskräften, entwickle sich Sylt in Richtung Disneyland, fürchtet ein Westerländer Unternehmer.
Für Aufregung sorgen auch die Punks, die derzeit recht zahlreich auf der Insel vertreten sind. Freie Zugfahrt für freie Bürger und Bürgerinnen. In Westerland tun sie das, was Punks eben tun, lärmen, trinken, schnorren, in Gruppen abhängen und eine gewisse Unordnung hinterlassen. Ansonsten sind Punks, auch wenn sie einem manchmal ganz schön auf die Nerven gehen können, im Großen und Ganzen vollkommen harmlos. Dafür verbürge ich mich, denn in einem meiner früheren Leben war ich eine Art assoziiertes Mitglied der Punkgemeinde.
Was Ressourcenverbrauch, Konsum und ökologischen Fußabdruck angeht, sind Punks übrigens – verglichen mit den meisten braven Bürgerinnen und Bürgern – geradezu vorbildlich, nur ihr Orientierungssinn lässt gelegentlich zu wünschen übrig (sie hatten sich selbst zur Lindner-Hochzeit eingeladen, spektakelten dann aber vor dem falschen Hotel).
Am anderen Ende des Spektrums hingegen erwirbt man für sieben, zehn oder zwölf Millionen, vielleicht auch mehr, ein Grundstück in Kampen, lässt das darauf befindliche noch nicht besonders alte Haus umgehend abreißen und baut ein neues, schöner (nun ja, das ist Geschmackssache), größer und mit der allertiefsten Tiefgarage. Ist das ganze Anwesen samt Außenanlage mit automatischer Bewässerung fertig, rückt eine Gartenbaufirma an, pflanzt Rasen und Rosen und bringt mit schwerem Gerät die Hecken in Kugelform. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Rosen und Kugelhecken, was anderes geht nicht. Disneyland eben.
Ziemlich viel Aufwand dafür, dass sich meist höchstens ein paar Wochen im Jahr jemand in so einem Luxusdomizil aufhält. Einen Tag nach unserer Abreise gab es, das 9-Euro Ticket machte es möglich, sogar eine linke Demo mit ein paar Hundert eigens Angereisten unter dem Motto: „Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten“. Stimmt schon, aber irgendetwas sagt mir, dass es in diesen Häusern, ob bewohnt oder unbewohnt, auch im kommenden Winter kuschelig warm sein und dass im kommenden Jahr unverdrossen weitergebaut werden wird. Energie und Ressourcen sparen? Hier eher nicht. Das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ist in einer Kugelhecke verschwunden.
Gestern war übrigens, wie komme ich da jetzt drauf, Erdüberlastungstag, Earth Overshoot Day. Wenn Sie den Blick in einer klaren Nacht gen Himmel richten, erspähen Sie vielleicht irgendwo im Weltall die Dreiviertelerde, die wir noch extra bräuchten, weil unser kleiner Planet es nicht allein schafft, alles Verbrauchte wieder zu ersetzen. In den bis Jahresende verbleibenden 156 Tagen lebt die gesamte Weltbevölkerung auf Pump (Deutschland allein hatte diesen Punkt schon Anfang Mai erreicht). Höchste Zeit also für die Erdentlastungsschuldenbremse.
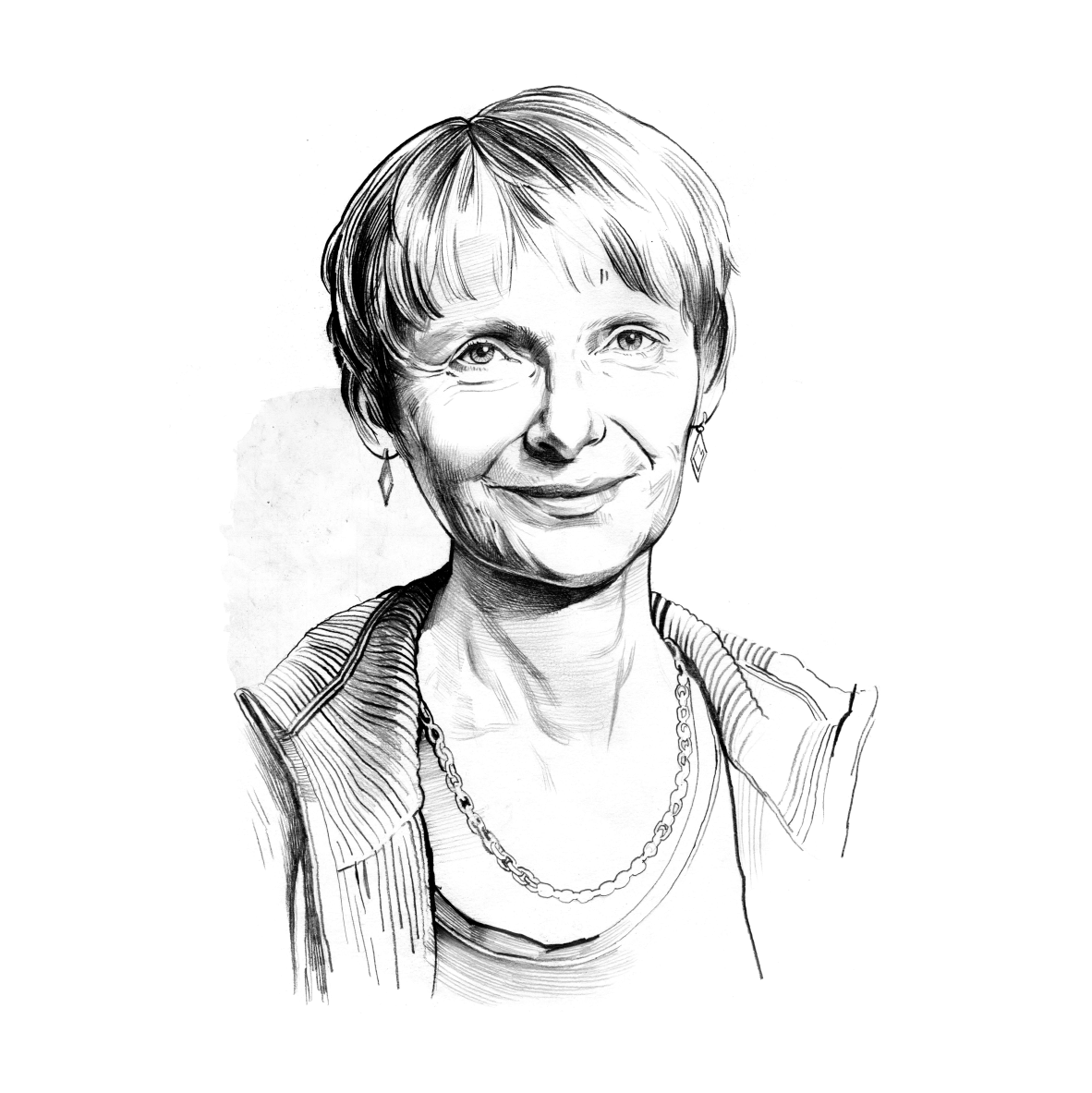
Kerstin Eitner
Redakteurin
Haku Sungho
Lorenz Halt
Erst der Handel, dann die Moral
Nun sind es mittlerweile 50 Tage. Während bei uns die Feiertage anstehen und suggerieren, wir könnten einfach mal den Pausenknopf drücken, geht das woanders nicht. Russland führt weiterhin Krieg in der Ukraine. Der Westen reagiert mit Sanktionen, wobei das oberste Prinzip, der Wirtschaft nicht zu schaden, zu teils abenteuerlichen Konstruktionen führt. Zwar haben sich EU und Verbündete entschlossen, sieben russische Banken vom Finanzinformationssystem Swift auszuschließen. Nur eben nicht die größte russische Bank Sberbank und die Gazprombank – denn beide sind für die Bezahlung der Energielieferungen relevant.
Und von denen sind Deutschland und andere EU-Länder abhängig. Das soll sich zwar ändern, aber eher peu à peu als ad hoc: Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck könnten russische Ölimporte nach Deutschland bis zum Sommer halbiert werden und zum Herbst hin will Deutschland auf russische Kohle verzichten. Erst im Sommer 2024, so heißt es, schaffen wir es, uns vom russischen Gas zumindest weitgehend unabhängig zu machen.
Andere Deals bleiben ganz ohne Ablaufdatum. So lautet die Antwort auf die Frage „Darf man mit einem kriegstreibenden Land Handel treiben?“ bei metallischen Rohstoffen anscheinend: Ja! Nach Informationen des ARD-Politikmagazins Kontraste hat sich die Bundesregierung in vertraulichen Gesprächen mit der EU erfolgreich dafür eingesetzt, bestimmte Metalle wie Nickel, Palladium, Kupfer, Eisenerz, Aluminium und Titan von neuen Russland-Sanktionen auszunehmen. Denn auf diese Rohstoffe ist Deutschlands Industrie angewiesen, auch beim Bau von Solaranlagen, Windturbinen und Batterien für Elektroautos.
Sprich: Die Energiewende, die uns mehr Unabhängigkeit von fossilen Energien verspricht, droht somit alte Abhängigkeiten zu verstärken oder neue zu schaffen. Das Dilemma, welchen Handelspartner man wählen soll, beginnt von vorne. Wobei die Auswahl beim Gas besonders dünn ist. Das weiß auch Robert Habeck, den es bei seiner Suche nach Flüssiggas und Wasserstoff bis nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate verschlug. Amnesty International spricht in einem aktuellen Bericht davon, dass in Katar Gastarbeiter zum Teil unter Bedingungen leiden, die an Zwangsarbeit grenzen. Und in Saudi-Arabien, das neben seiner Ölförderung auch seine Gasproduktion ausweiten will, berichteten Staatsmedien im März von 81 Exekutionen an einem Tag. Wo also liegt die moralische Grenze für Handelsbeziehungen: bei Krieg, ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, rigiden Abtreibungsverboten, verschmutzten Flüssen, der Todesstrafe?
Die aktuelle Debatte zeigt, wie schwierig es ist, eine Balance zwischen ethischen Ansprüchen und wirtschaftlichen Interessen zu finden. Deshalb müssen wir uns die Frage gefallen lassen, nach welchem Prinzip sich unsere Handelspolitik eigentlich langfristig ausrichten soll: Wirtschaftlichkeit oder Moral?
Lieferkettengesetze sind ein erster Schritt in Richtung einer ethisch geleiteten Handelspolitik. Deutschland und Staaten wie Großbritannien, Frankreich und Australien haben Gesetze auf den Weg gebracht, die Unternehmen verpflichten, Menschenrechte bei der Produktion zu beachten. Bei uns tritt solch ein Gesetz am 1. Januar 2023 in Kraft, es wurde letztes Jahr beschlossen. Bis dato sollten sich Unternehmen freiwillig zu fairem Handel verpflichten. Dieses Experiment ging gründlich schief, über 80 Prozent der Firmen kamen ihren Sorgfaltspflichten nicht nach.
Jetzt will die EU nicht nur nachziehen, sondern es besser machen. Im Gegensatz zum deutschen Gesetz, dessen Entwurf meine Kollegin Frauke Ladleif seinerzeit enttäuscht kommentierte, fällt der Entwurf der EU-Kommission strenger aus.
Prinzipiell sollen die erfassten Unternehmen überprüfen, woher ihre zugelieferten Waren kommen, wie sie hergestellt wurden und welche Folgen damit für Mensch, Klima und Umwelt einhergehen. Das schließt nicht nur die direkten Lieferbetriebe, sondern die komplette Lieferkette ein – von den Rohstoffen bis zur Ware. Zudem ist eine Haftungsklausel vorgesehen, nach der Opfer leichter Zugang zu Gerichten haben. Auch ist ein Importverbot für Waren, die unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt werden, im Gespräch.
Derzeit wird der Kommissionsentwurf im Europäischen Parlament und Rat verhandelt. Während die Wirtschaft über den hohen Bürokratieaufwand stöhnt und Wettbewerbsverzerrungen befürchtet, geht es den Verfechtern von Umweltschutz und Menschenrechten nicht weit genug.
Greenpeace-Handelsexperte Jürgen Knirsch sagt: „Lieferkettengesetze gehen in die richtige Richtung, weil sie versuchen, die schlimmsten Auswüchse des Welthandels zu begrenzen, aber sie stellen seine Prinzipien nicht grundsätzlich in Frage.“ Krieg wie auch Pandemie hätten uns gezeigt, wie anfällig die globalen Lieferketten sind. Nun sei es Zeit, zu handeln: „Wir müssen den Welthandel vollkommen anders aufstellen, dafür braucht es einen radikalen Paradigmenwandel: Wirtschaftliche Erwägungen dürfen nicht mehr ausschlaggebend sein, sondern die Auswirkungen für Menschen, Arbeitsnormen, Klima und Umwelt müssen an erster Stelle stehen.”
Ein Weltmarkt, der durch Austausch und Fairness reguliert wird, ist ein utopischer Zukunftsblick. Genauso wie das Streben hin zu einem neuen Verständnis von Außenpolitik, wie es die Autorin Kristina Lunz fordert. Ginge es nach ihr, würden wir Krisen mit Verständigung und Inklusion lösen, statt mit Krieg und Aufrüstung. Autokratische Männer an der Spitze, die Aggression mit Stärke verwechseln, wären nur noch eine blasse Erinnerung vergangener Zeiten. Für das aktuelle Dilemma aber bleibt die nüchterne Erkenntnis: Maßnahmen wie Handelssanktionen können höchstens mittel- und langfristige Effekte haben. Den Krieg in der Ukraine stoppen sie nicht.
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gerne weiter. Abonnieren können Sie den Newsletter übrigens hier. Wenn Sie auch gerne unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimaschutzthemen zugeschickt bekommen wollen, sollten Sie sich hier dafür eintragen – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!
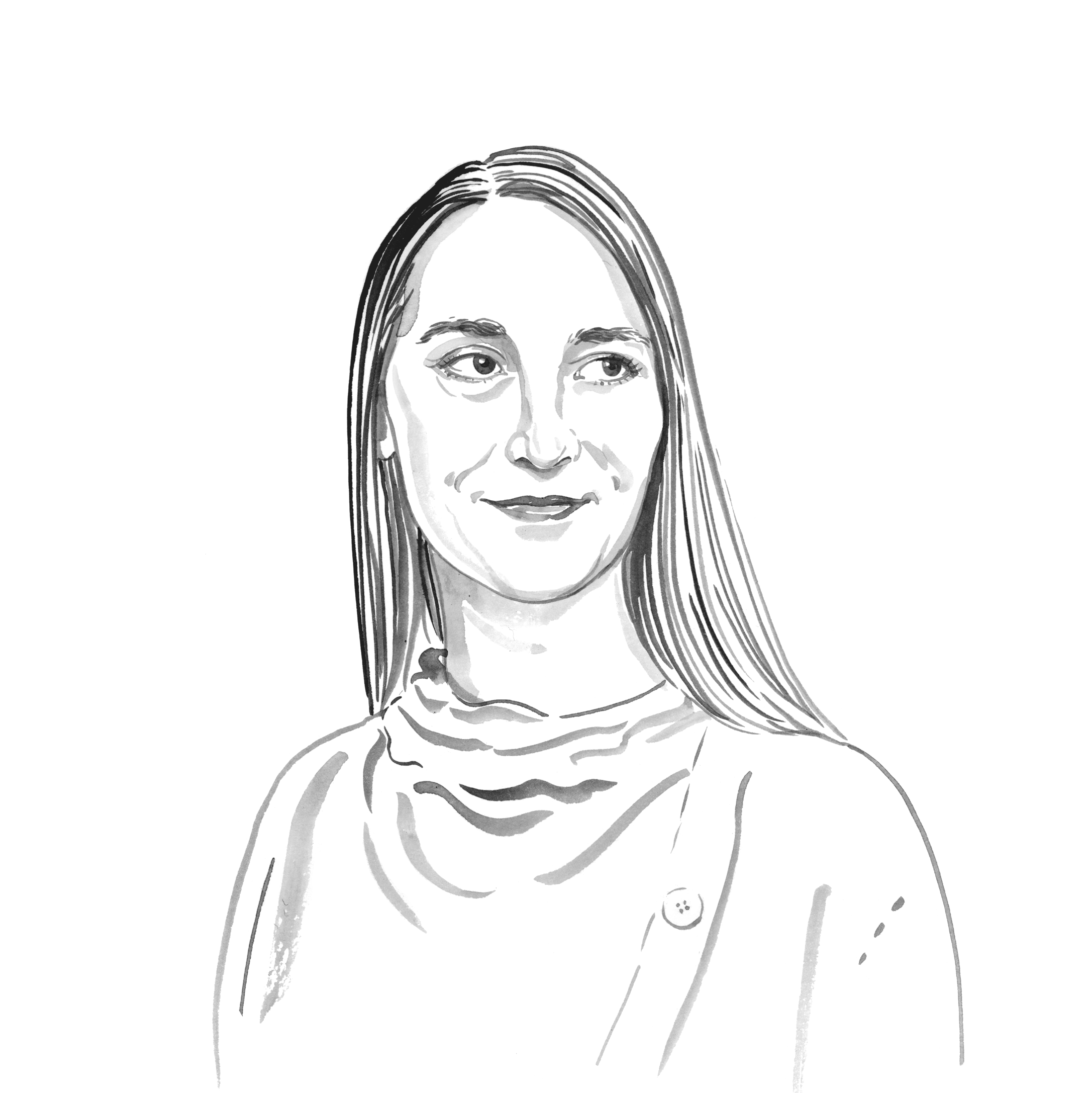
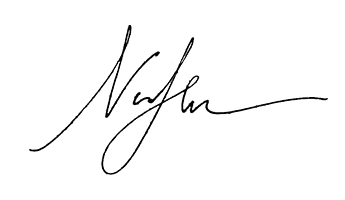
Nora Kusche
Redakteurin